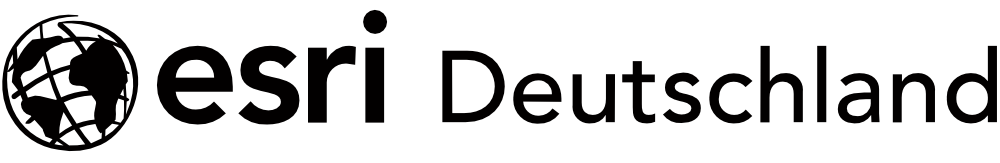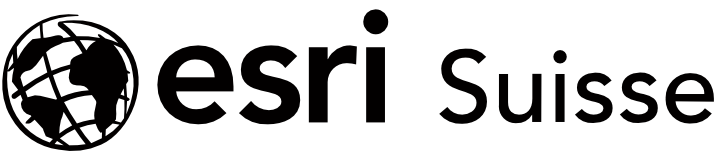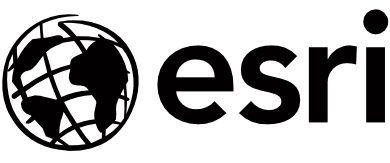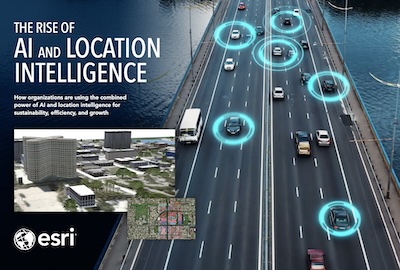In der Stadt der Zukunft sind Daten genauso wertvoll wie die Straßen oder das Stromnetz. Für Bürgermeister und Digitalisierungsverantwortliche bedeutet das: Die Wahl der Datenplattform entscheidet über den Erfolg der Smart-City-Strategie.
Berlin, München, Hamburg – wer sich in einer dieser drei deutschen Städte bewegt, braucht vor allem eines – Geduld. 2018 stand ein Autofahrer durchschnittlich 120 Stunden im Stau, wie der Verkehrsdatendienstleister Inrix herausfand. In der bayrischen Hauptstadt waren es sogar 140 Stunden. Die Stau-Krone sichern sich die Berliner Autofahrer mit 154 Stunden.
Dass sich dieses Problem nicht von selbst in Luft auflöst, liegt auf der Hand. Im Gegenteil: Bereits heute leben in Deutschland drei Viertel der Bevölkerung in Städten – Tendenz steigend. Feinstaub, Lärm und fehlende Parkplätze zählen die Bürger zu den größten Stressfaktoren.
Für Bürgermeister und Landräte sind diese Herausforderungen kein Novum. Die Frage nach der Gestaltung eines lebenswerten Miteinanders ist seit jeher ihr Auftrag. Doch wie sie Antworten auf ihre Fragen finden, das ist neu. Schon heuten fallen in den Städten im Sekundentakt gigantische Mengen an Daten an. In der Smart City werden sie zum zentralen Baustoff. Vom digitalen Amt bis zur intelligenten App zur Parkplatzsuche – nichts funktioniert ohne Daten.
Wie aus Parkticketdaten saubere Straßen werden
Intelligent miteinander verknüpft und kartenbasiert analysiert, eröffnen Daten vollkommen neue Möglichkeiten. Los Angeles zeigt beispielsweise, wie Parkticketdaten zu mehr Sauberkeit in der Stadt führen. Was zunächst nichts miteinander zu tun hat, ist bei genauerem Hinsehen sinnbildlich für die Stadt von morgen: Alles hängt zusammen und birgt – als großes Ganzes betrachtet – ungeahnte Synergiepotentiale.
Ein Beispiel: 2016 zahlten Parksünder an die Stadt Los Angeles rund 148 Millionen Dollar. Klingt nach einem guten Geschäft für die Stadt? Dass hiervon gleich wieder drei Viertel für die Bekämpfung von Falschparken ausgegeben werden müssen und die Stadtreinigung aufgrund zugeparkter Straßen blockiert wird, haben viele Bürger nicht auf dem Zettel.
Grund genug für Los Angeles mit einem innovativen Portal online den Bürgern genau aufzuzeigen, was Falschparken alles nach sich zieht und was es dem Steuerzahler wirklich kostet. Diese interaktiven Analyseergebnisse sind aber nicht nur als Aufmerksamkeitsmacher und als Quelle für Journalisten wertvoll. Die analysierten Daten (Parktickets, Straßenkarten, etc.) ermöglichen es der Verwaltung auch Abläufe zu optimieren. So sieht beispielsweise das Straßenverkehrsamt, wo neue Schilder oder Parkplätze weiterhelfen oder die Verkehrszentrale, wie sich die innerstädtische Logistik verbessern lässt.
Daten richtig in Szene setzen
Wo gibt es den größten Rückstau? Wie breitet sich Lärm entlang von Fassaden aus? Oder: Für welchen Teil des Energienetzes steht die nächste Wartung an? – nahezu alle Fragen in Städten haben einen Raumbezug. Eine zentrale Smart City-Datenplattform sollte daher neben Sensor- und Echtzeit– insbesondere raumbezogene Daten verarbeiten.
Darüber sind folgende Kriterien wegweisend:
- Kompatible, offene Schnittstellen, um die Smart City Devices von morgen zu integrieren und Städten in Zukunft die Datenhoheit zu sichern
- Visualisierungswerkzeuge, um datenbasierte Erkenntnisse in einer leicht verständlichen Form darzustellen – idealerweise mit interaktiven Karten
- Datensilos vermeiden und Verwaltungen, Bürger und Unternehmen sicher vernetzen
Ganzheitlicher Blick entscheidend
Doch bevor Daten zu echten Erkenntnisse werden, bedarf es der richtigen Strategie. Dass sich viele deutsche Städte bereits mitten auf dem Weg ihrer Digitalisierungsreise befinden, zeigt der Bitkom Smart City Atlas. Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus beweist, wohin die Reise gehen kann. In Wien können Bürger beispielsweise schon heute 200 Amtswege online erledigen.
Wie visuelle Werkzeuge Städten und Regionen helfen, transparente Entscheidungen zu treffen, lesen Sie im kostenfreien E-Book.