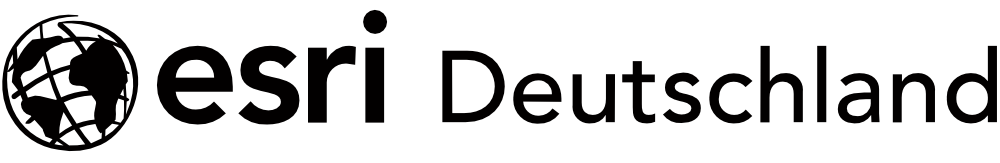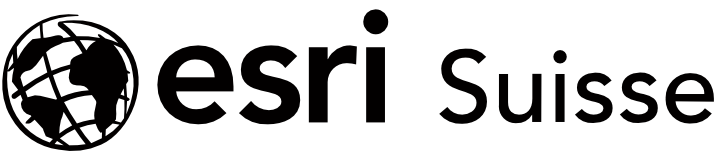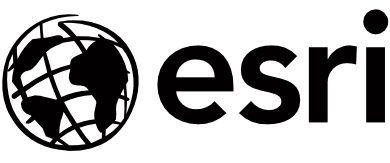Aufgrund des Klimawandels ist es notwendig, überschüssiges CO2 der Atmosphäre zu entziehen. Carbon Farming wird dabei als ein möglicher Ansatz angesehen. Mit Methoden der Fernerkundung lässt sich die CO2-Aufnahme in der Biomasse messen, um anschließend eine Bilanz zu erstellen.
Seit mehr als 30 Jahren wissen wir, dass durch die Nutzung fossiler Energieträger die Atmosphäre mit CO2 angereichert wird. Kohlendioxid ist für den Glashauseffekt mit verantwortlich und sorgt dafür, dass die globalen durchschnittlichen Temperaturwerte sukzessive ansteigen.
Neben einer Vermeidungsstrategie wird es in Zukunft darauf ankommen der Atmosphäre überschüssiges Kohlendioxid wieder zu entziehen. Technische Anlagen, die Kohlendioxid binden und im Boden einlagern, werden zur Zeit getestet.
Klar ist, dass Kohlendioxid auch durch Pflanzenwachstum gebunden wird. Allerdings ist der Kohlenstoff dort in einem natürlichen Kreislauf, von Auf- und Abbauprozessen, von Biomasse und Humus, einem ständigen Wandel unterzogen.
Carbon Farming: Eine zusätzliche Einnahmequelle für Landwirte?
Carbon Farming bedeutet, Kohlenstoff auf landwirtschaftlichen Flächen zu binden. Die Methode zielt darauf ab, das klimawirksame Gas CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen und soll den Landwirten finanziell vergütet werden. Durch Pflanzenwachstum wird der Kohlenstoff, der bei der Verbrennung fossiler Energie emittiert wurde, wieder gebunden. Dieser Prozess, bei dem der atmosphärische Kohlenstoff in die Biomasse der Kulturpflanzen eingebaut wird, soll über einen Zertifikatshandel finanziell ausgeglichen werden.
Was vom Ansatz her zunächst einfach klingt, ist bei genauerem Hinsehen sehr komplex. Der Kohlenstoff verbleibt, nachdem er in die Biomasse von Pflanzen eingebaut wurde, in wesentlichen Teilen nur ein paar Wochen oder Monate in der Pflanze. Die Biomasse und der darin gebundene Kohlenstoff unterliegen saisonalen Wachstums- und Zersetzungsprozessen.
Kohlenstoffkreislauf in der Landwirtschaft
Pflanzen werden angebaut und am Ende der Saison geerntet. Mit Methoden der Fernerkundung lässt sich zwar das Pflanzenwachstum beobachten und mit Modelrechnungen auch bilanzieren, wie viel Kohlenstoff von den Pflanzen aufgenommen wurde, allerdings lassen sich mit dieser Technologie nicht die weiteren Abbauprozesse der Pflanzenrückstände und des Humus bilanzieren.
Wir sehen in der Regel nicht wie viel Biomasse auf dem Feld verbleibt bzw. als Erntegut abgefahren wurde. Biomasse ist u.a. auch in den Wurzeln vorhanden.
Die verbleibende Biomasse wird anschließend von Mikroorganismen umgewandelt.
Es entsteht zunächst Humus. Humus wird jedoch in der Folgezeit teilweise auch wieder abgebaut bzw. mineralisiert und liefert Nährstoffe für die folgende Generation von Kulturpflanzen. Will man also den Kohlenstoffentzug aus der Atmosphäre auf einer Ackerfläche bilanzieren, müsste man letztlich die Humusgehalte im Boden messen. Diese verändern sich in geringen Wertebereichen von 1/10 Prozent und unterliegen einer räumlichen Variabilität, so dass für ein Flurstück keine signifikanten Messunterschiede in wenigen Jahren zu erwarten sind.
Dennoch wäre es wünschenswert, wenn man mit Satellitendaten den Entzug von Kohlenstoff durch ein Monitoring beobachten und quantifizieren könnte, weil man diese Leistung der Landwirtschaft für das Klima, den Bauern vergüten will und diese Vergütung möglichst fair sein sollte. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Ökosysteme.
Bedeutung von Mooren
Wie verteilen sich die nicht fossilen Kohlenstoffreserven auf die verschiedenen Ökosysteme? Da wären zuvorderst die Moore zu nennen. Obwohl deren Ausdehnung nur 5 % der nicht besiedelten Landfläche ausmacht, sind dort 72 % des organischen Kohlenstoffs gebunden. Pro Hektar sind in Mooren durchschnittlich mehr als eine Tonne organischen Kohlenstoffs gebunden. Damit überragen Moore als Kohlenstoffspeicher Wälder fast um das Zehnfache in Bezug auf ihre Hektarleistung.

Schutz und Renaturierung von Mooren
Diese Zahlen verdeutlichen, welche übergeordnete Bedeutung Mooren und Feuchtgebieten zukommt. Dabei ist klar, dass es nicht nur darum gehen kann, Moore zu renaturieren, um deren Ökosystemleistungen zu fördern. Es muss vor allem auch darum gehen, bestehende Moore zu schützen, um den im Humus gespeicherten Kohlenstoff weiterhin im Boden zu belassen und ihn davor zu bewahren in die Atmosphäre zu gelangen.
Moore werden zerstört, indem man sie trockenlegt und den Torf abbaut oder sie in Acker- oder Weideland umwandelt. Torf wird abgebaut, um daraus Substrate für den Zierpflanzenbau herzustellen. Letztlich endet der Torf in der Gartenerde, wo der Humus in einem kurzen Zeitraum abgebaut wird und der Kohlenstoff in Form von CO2 freigesetzt wird. Teilweise wird Torf auch noch in Kraftwerken zur Stromgewinnung verbrannt.
Die Veränderungen, die mit der Zerstörung eines Moorgebietes einhergehen, lassen sich mit Mitteln der Fernerkundung beobachten. Wir wissen, wo Moorgebiete sind und können diese in einem GIS kartieren. Mit Hilfe von Fernerkundung können wir beobachten, ob sich die Bodenfeuchte drastisch ändert, ob Gräben gezogen wurden, in denen das Bodenwasser abfließen kann, und ob dort Torf abgebaut wird.
Die Rolle von GIS in der Überwachung von Landnutzungsänderungen
Geoinformationssysteme (GIS) sind ein unverzichtbares Werkzeug in der Umweltüberwachung und -verwaltung. Durch die Analyse von Satellitenbildern und Vektordaten ermöglichen GIS die Identifikation von Veränderungen in der Landnutzung oder deren Zustand z.B. bei der Bodenfeuchte. Dies hilft nicht nur bei der Planung von Renaturierungsmaßnahmen sondern auch bei der Überwachung bestehender Schutzgebiete.
Es ließe sich z.B. beobachten, ob ein zuvor trockengelegtes Moor renaturiert wurde und ob diese Maßnahme dazu führt, dass die Bodenfeuchte über das Jahr gesehen auf einem hohen Niveau bleibt. Man würde sehen, ob auf diesen Flächen weiterhin eine Beweidung oder Ackerbau stattfindet und könnte dann entsprechend eine Kompensation auszahlen oder Sanktionen aussprechen.
Weitere organische Kohlenstoffspeicher
An zweiter Stelle ist Dauergrünland zu nennen, das mit 31 % der unbebauten Landfläche ca. 11 % des im Boden gebundenen Kohlenstoffs speichert. Die Hektarleistung wird mit 158 Tonnen gespeichertem Kohlenstoff angegeben. Bei diesem Dauergrünland handelt es sich teilweise um Flächen, die zuvor durch Drainage entwässert wurden. Dies wären Flächen, die sich wieder renaturieren ließen und dann nicht mehr als Grünland, sondern als Feuchtwiese oder Moor fungieren könnten.
Man kann zudem mit Fernerkundung beobachten, ob Dauergrünland tatsächlich dauerhaft begrünt ist oder ob es ggf. umgebrochen wurde, um daraus Ackerland zu machen. Falls einem Landwirt die Umwandlung von Ackerland zu Dauergrünland vergütet wurde, lässt sich mit Hilfe von Fernerkundung überprüfen, ob der Landwirt das Grünland weiterhin als solches bewirtschaftet.
An dritter Stelle stehen die Wälder mit 8 % des organisch gebundenen Kohlenstoffs auf 27 % der unbebauten Landfläche. Die Menge an gebundenem Kohlenstoff pro Hektar wird mit 112 Tonnen angegeben und liegt damit nochmals etwa 1/3 unter dem Grünland. Wälder sind Dauerkulturen in unterschiedlichster Ausprägung. Wir kennen Auwälder, Nadel-, Laub- und Mischwälder, boreale Wälder und Regenwälder, um nur die wichtigsten zu nennen. Sie alle haben im Zuge des Klimawandels mehr oder weniger mit Trockenheit, Feuer und Schädlingsbefall zu kämpfen. Aufforstungsmaßnahmen und Waldverlust lassen sich mit Hilfe der Fernerkundung erfassen. Die Prozesse in den Waldböden lassen sich nicht mit Fernerkundung erfassen. Es sollte vor allem darum gehen, dass diese Waldflächen möglichst durchgängig von Bewuchs bedeckt sind, um den Boden zu schattieren, ihn vor Erosion zu schützen und den Humusabbau zu reduzieren.
Erst an vierter Stelle steht Ackerland. Auf 12 % der unbesiedelten Landfläche wird Ackerbau betrieben, und auf diesen Flächen sind 5 % des organisch gebundenen Kohlenstoffs gespeichert. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass humusreiche Böden mehr Kohlenstoff speichern als humusarme Böden, und daher sollte es das Ziel sein, auf diesen Böden den Humusaufbau zu fördern, um darin mehr Kohlenstoff zu speichern.
Konkrete Maßnahmen
Maßnahmen, die dem Humusaufbau förderlich sind, könnten einerseits pauschal gefördert werden und andererseits mit Hilfe von Fernerkundung überwacht werden. Da wäre zunächst eine bodenschonende Bewirtschaftung zu nennen. Im Wesentlichen bedeutet eine schonende Bodenbewirtschaftung eine möglichst flachgründige Bodenbearbeitung, da dadurch die Mineralisation von Humus reduziert wird.
Zudem wird durch eine flachgründige Bodenbearbeitung über die Jahre die Entwicklung eines größeren Porenvolumens gefördert. Dies begünstigt die Drainage von Regenwasser und die Durchlüftung des Bodens.
Parallel dazu ist es wünschenswert, den Boden möglichst ganzjährig zu begrünen. Das heißt, Zwischenfrüchte und Untersaaten als Gründüngung in die Fruchtfolge zu integrieren. Mehrgliedrige Fruchtfolgesysteme fördern zudem die Biodiversität, die für die Ressilienz der Ökosysteme von übergeordneter Bedeutung ist. Der Anbau von Hecken als Wind- und Erosionsschutz sowie kleinteilige Strukturen, die man im Zuge der Mechanisierung egalisiert hat, wären ebenfalls förderlich für die Biodiversität.
Auch solche Maßnahmen lassen sich mit Hilfe von Fernerkundung beobachten.
Diese ökologischen Leistungen verlangen von den Landwirten zusätzlichen Aufwand und sind mit geringerem Ertrag verbunden. Ein angemessener finanzieller Ausgleich ist daher nur fair.
Zusammengefasst muss man feststellen, dass eine vollständige Bilanzierung des Kohlenstoffs mit Hilfe der Fernerkundung nicht möglich ist. Es ist allerdings möglich, Maßnahmen zu überwachen, die den Humusaufbau begünstigen, und zwar sowohl im Acker- als auch im Grünland.
Bei Wäldern geht es vor allem darum nach Kalamitäten den Boden nicht ungeschützt zu lassen. Eine dauerhafte Begrünung durch ein- und mehrjährige Pflanzen kann mit Fernerkundungsmaßnahmen lückenlos dokumentiert werden.
Moore sind aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als besonders schützenswert anzusehen. Daher wäre es zweckmäßig, diese unter ständige fernerkundliche Beobachtung zu stellen, um ihren Schutz zu gewährleisten.
Autor

Dietrich Heintz
ist bei Cropix für GIS und Remote Sensing zuständig.