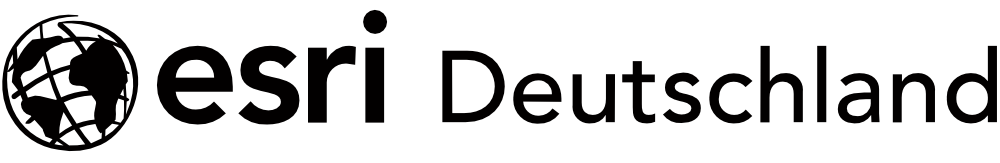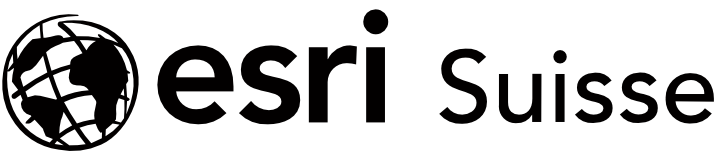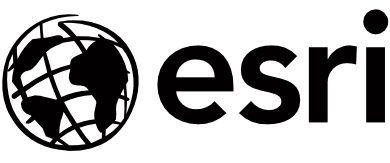Regen ist heute nicht mehr nur Regen. Immer mehr Kommunen sind mit sogenannten Starkregenereignissen konfrontiert. Doch was tun, wenn die Sturzflut naht?
Wir sprechen mit Dr.-Ing. Stefan Ostrau, Fachbereichsleiter Geoinformation, Kataster und Immobilienbewertung beim Kreis Lippe sowie Vertreter des Deutschen Landkreistages im Lenkungsgremium GDI-DE. Der in der Geoinformations- und Digitalisierungswelt gut vernetzte Fachmann weiß aus langjähriger Erfahrung, wie sich Kommunen auf Extremwetterereignisse vorbereiten.
Im Interview berichtet er vom Projekt in der Gemeinde Kalletal und verrät, wie Drohnendaten und 3D-Visualisierungen frühzeitige Antworten geben.
Unser Klima verändert sich. Wie rasant nehmen Ihrer Beobachtung nach Starkregenereignisse zu?
Bei Starkregenereignissen handelt es sich um kurzzeitig auftretende Niederschläge ungewöhnlich hoher Intensität mit Niederschlagsmengen von >25 l/m² pro Stunde. Diese treten meist lokal begrenzt auf. Häufigkeit und Intensität haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Aussagen der Wetterdienste über räumliche und zeitliche Intensität sind derzeit schwer möglich.
Auf die Folgen des Klimawandels sind die meisten Kommunen nicht vorbereitet. Zu komplex sind die Aufgaben. Im Zusammenhang mit Starkregenereignissen fehlt demzufolge oftmals ein lokales „Drehbuch“ über erforderliche Maßnahmen und Ressourcen. Die Forderung der Bevölkerung nach vorbeugenden Maßnahmen wird allerdings immer lauter. Die Kommunalpolitik steht folglich unter erheblichem Handlungsdruck.
Die Gemeinde Kalletal setzt auf moderne Technologie zur Prävention. Können Sie für unsere Leser kurz zusammenfassen, worum es in dem innovativen Projekt geht und wie die Zusammenarbeit zustande kam?
Starke Unwetter in 2014 und 2019 haben in den Dörfern Bentorf, Kalldorf und Lüdenhausen zu erheblichen Überflutungen geführt. Ausgehend von höher liegenden Feldern und Äckern verursachten die Wassermassen regelrechte Schlammfluten. Keller liefen voll, Schlamm sammelte sich in Vorgärten, Mulden und auf Straßen. Die örtliche Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Angesichts dieser komplexen Ausgangssituation ist der Bürgermeister der Gemeinde Kalletal Anfang 2020 an den Kreis Lippe herangetreten. Gemeinsam initiiert wurde ein Modellprojekt mit dem Ziel, eine interaktive „Starkregengefahrenkarte“ für die gesamte Gemeinde zu erarbeiten. Dieses soll in einem weiteren Schritt auf das gesamte Kreisgebiet übertragen werden. Quasi digitale Daseinsvorsorge in einer neuen Qualität und Aussagekraft. Im Mai 2020 wurden erste Ergebnisse der Lokalpolitik und der örtlichen Presse vorgestellt. Zudem hat auch das ZDF (Terra Xpress) erhebliches Interesse an dem Projekt gezeigt.
Trockenheit auf der einen Seite, Starkregen auf der anderen – mehr zur Ressource Wasser in Deutschland sehen Sie in diesem ZDF-Video.
Wie sind Sie bei der Analyse in Kalletal genau vorgegangen und welche Fragestellungen und Technologien spielen eine Rolle?
Zielsetzung ist es, zukünftig auf außergewöhnliche Regenereignisse nicht nur zu reagieren, sondern Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Dabei stellen sich beispielsweise Fragen, welchen Weg das Oberflächenwasser nimmt, wo es sich sammelt und welche Bereiche besonders gefährdet sind. Zur Risikoanalyse mussten pragmatische schnelle Lösungen her, keine langwierigen Studien und Analysen.
Eine Vielzahl von Daten wurden Dienste basiert vernetzt: ALKIS-Daten, DGM, 3D-Gebäude, Orthophotos, UAV-Punktwolken, HQ-50/100-Karten, Vegetations-, Bodenerosions- und Schutzgebietsinformationen sowie Bauleitplandaten. Mit Hilfe von Geoprozessen (Geo-AI) sind Abflusssimulationen (Watershed-Modelle) und Wassereinzugsbereiche sowie Fließwege und Überflutungsszenarien berechnet worden. UAV-Befliegungen dienen dazu, die ermittelten Gefahrenstellen noch detaillierter zu bestimmen und mit den Schadensereignissen der letzten Jahre zu vergleichen. Eingeflossen sind zudem Beobachtungen und Filmaufnahmen der Bevölkerung.
Sämtliche Daten wurden in Form eines Digitalen Zwillings vernetzt und für die Öffentlichkeit als WebSzene bereitgestellt. Hier setzen dann konkrete örtliche Maßnahmen an, z.B. Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung, Sicherstellung des überstaufreien Betriebs für Bemessungsregen sowie Überflutungsschutz und -vorsorge.
Das Modell ist weiterzuentwickeln, beispielsweise durch Volumenbetrachtung der Niederschlagsbelastung oder auch durch Analyse der Oberflächeneigenschaften. Wir arbeiten zudem mit verschiedenen Partnern daran, Echtzeitdaten von Pegelständen zu integrieren. Diese ermöglichen bessere Prognosen von Gefahrenlagen sowie längere Vorwarnzeiten.
Wie müssen Geoinformationen aufbereitet sein, um verständlich und nutzerfreundlich die Personen vor Ort bei ihrem Risikomanagement zu helfen?
Mit Blick auf „smarte Regionen“ geht es um den Aufbau einer zukunftsorientierten Geodateninfrastruktur. Die zentralen Stichworte sind integrative Systeme, offene Schnittstellen und urbane Datenplattformen. Auf diese Weise lassen sich Geoinformationen mit reibungsfreiem Datenaustausch in einem 3D-Modell darstellen. Auch weitere Daten sind integrierbar, beispielsweise BIM- und Echtzeitdaten (Sensorsysteme). Die bereits in der Praxis eingesetzten 3D-Modelle sind vielversprechend, bedürfen allerdings noch der Weiterentwicklung.

Mit Blick auf smarte Regionen geht es um den Aufbau einer zukunftsorientierten Geodateninfrastruktur.
Dr. Stefan Ostrau, Fachbereichsleiter Geoinformation, Kataster und Immobilienbewertung beim Kreis Lippe
Für die Öffentlichkeitsarbeit – beispielsweise für Politik, Bürger und Presse – sind die Informationen erheblich zu abstrahieren. Es gilt der Grundsatz: Weniger ist manchmal mehr. Die praktische Lösungsorientierung sollte im Vordergrund stehen. Dazu bieten sich anschauliche Präsentationen in Story-Telling Form oder auch aussagekräftige 3D-Szenen an. Die Erfahrungen zeigen, dass diese in Veranstaltungen zu lebhaften und konstruktiven Diskussionen über Maßnahmen führen.
Viele Kommunen setzen derzeit auf kostenintensive Analysen und Konzepte. Unseres Erachtens ist es dabei unverzichtbar, auf die technische Weiterverarbeitung der Geoinformationen zu achten. Mit Blick auf den Aufbau kommunaler Datenplattformen sollten zudem bestimmte Datenstandards erfüllt werden. Es geht dabei letztlich um die kommunale Datensouveränität und um den Ausbau der Geodateninfrastruktur.
Starkregenereignisse stellen auch besondere Anforderungen an die Aktualität der Daten. Aktualitätszyklen der Daten sollten daher möglichst verkürzt werden.
Wie würde Ihrer Meinung nach ein ideales Risikomanagement zum Thema Starkregen aussehen?
Daseinsvorsorge muss zukünftig noch viel stärker auf die Digitalisierung setzen. Vor diesem Hintergrund sind auch die politisch Verantwortlichen auf lokaler Ebene noch stärker als bisher über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten räumlicher Daten zu informieren. Aktuell gibt es keine Blaupause eines idealen Risikomanagements. Wirksame Vorsorgekonzepte können zudem nur lokal als gemeinsame Aufgabe aller kommunalen Akteure entwickelt und umgesetzt werden. Hier genau liegt auch die Chance der Geodatenmanager vor Ort, eine prägende Rolle zu übernehmen.
Überflutungsgefährdungen spielen auch in der kommunalen Bauleitplanung eine erhebliche Rolle. Sie sind entscheidend für die Beurteilung von Baugebieten und Einzelbauvorhaben. Abgleiche sind hier unverzichtbar, was eine Kopplung von Planungsdaten und interaktivem Überflutungsmodell voraussetzt. Zudem lassen sich auch Flächen- und Umweltschutzdaten integrieren. Das interkommunale Geodatenmanagement kann demzufolge – entsprechende Initiativen vorausgesetzt -erheblich weiterentwickelt werden.
Insgesamt nehmen 3D-Modelle (Digitale Zwillinge) eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung ein – von der Risikokommunikation (Starkregen) über die Weiterentwicklung einer ressourcen- und umweltschonenden Bauleitplanung bis hin zum Umweltmonitoring.
Hochwasser: Digitale Gefahrenkarten ermöglichen eine datenbasierte Risikoprävention und ein vernetztes Krisenmanagement. Wie genau, lesen Sie in diesem Beitrag.