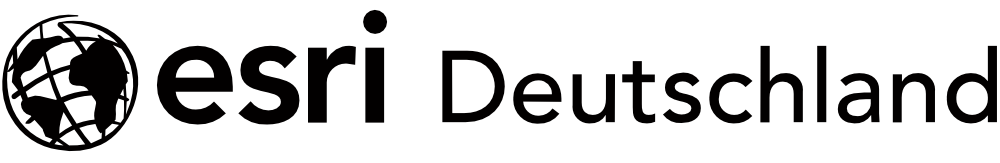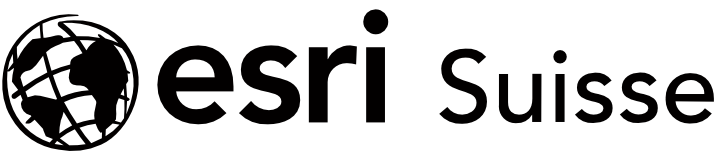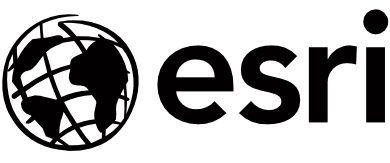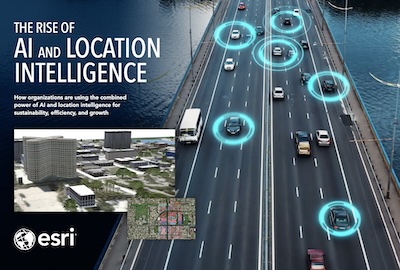Cloud, BIM und GIS bilden für Dipl.-Ing. Steffen Scharun, Head of BIM bei Obermeyer Infrastruktur, das Gerüst für zeitgemäßes digitales Planen und Bauen. Die Technologien sind die zentralen Bausteine eines digitalen Zwillings der analogen Welt. Und sie sorgen für Effizienz, sparen Zeit und Kosten, reduzieren Fehler – und zahlen auf mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen ein.
Was steht bei Obermeyer am Anfang der digitalen Planung eines Infrastrukturprojekts?
Scharun: Zunächst wird ein Bestandsmodell erstellt, das die Ist-Struktur eines Bauwerks mit allen erforderlichen und verfügbaren Informationen darstellt und die Basis für die weitere Bearbeitung bildet. Der Informationsinhalt richtet sich nach den spezifischen Projektanforderungen. Das Bestandsmodell kann zum Beispiel auf Grundlage von 2D-Planunterlagen, GIS-Daten und Punktwolken aus Laserscanning-Verfahren erstellt werden. Viele Daten sind mittlerweile öffentlich zugänglich und können relativ einfach aufbereitet werden.
Wie war das früher?
Scharun: Bisher war es üblich, Archive nach Informationen zu durchforsten und Ortsbegehungen des kompletten Projektbereichs durchzuführen, um die oftmals unzureichende Bestandsdatenlage zu verbessern. Die Bestandssituation wurde dann manuell mit Messrad, Maßband, Klemmbrett oder Fotoapparat erfasst und analog dokumentiert. Die überwiegend analogen Ergebnisse solcher Begehungen entsprechen in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr dem Status quo und erfordern eine aufwendige und fehleranfällige Nachbearbeitung.

Steffen Scharun
Head of BIM bei Obermeyer Infrastruktur
Welche Werkzeuge kommen heute zum Einsatz?
Scharun: Zum Einsatz kommen Werkzeuge zur Bauwerksdatenmodellierung: Building Information Modeling oder kurz ´BIM´ sowie die Daten aus Geoinformationssystemen. In den frühen Leistungsphasen, in denen es darum geht, verschiedene Varianten zu erarbeiten und gegenüberzustellen, werden vor allem CAD-Werkzeuge verwendet. Die Entwürfe werden dann mit den GIS-Daten kombiniert, beispielsweise, um räumliche Widerstände zu entdecken und die Vorzugsvariante zu ermitteln.
Was sind die Vorteile?
Scharun: Der Einsatz der Technologien spart nicht nur Zeit, sondern unterstützt durch die Visualisierungsmöglichkeiten auch die Kommunikation mit Bürger:Innen und Stakeholdern. Die Auswirkungen der Planungen werden deutlich und es lassen sich verschiedene Varianten gegeneinander abwägen.
BIM und GIS kommen auch bei Planung und Bau des Brenner Nordzulaufs zum Einsatz. Wo entsteht diese Bahntrasse?
Scharun: Der Brenner Nordzulauf ist eingebettet in einen europäischen Eisenbahn-Korridor. Hauptobjekt ist der Brenner-Basistunnel, der sich bereits im Bau befindet. Die Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG hat vor kurzem von der DB Netz AG den Zuschlag für die Erstellung der Grundlagenermittlung und Vorplanung für die Neubaustrecke zwischen Grafing und Ostermünchen erhalten. Der rund 15 Kilometer lange Planungsabschnitt ist Teil der nördlichen Zulaufstrecke zum Brenner Basistunnel. Er ist Teil des Skandinavien-Mittelmeer-Korridors, der wichtigsten Nord-Süd-Eisenbahnverbindung in Europa von Finnland bis Malta. Neben den offenen Streckenabschnitten werden auch die zugehörigen Verkehrsanlagen, Brücken und Tunnelbauwerke geplant.
Was sind die Herausforderungen?
Scharun: Die Herausforderungen bei diesem Projekt sind in erster Linie die effiziente Planung, die transparente Dokumentation sowie die Bürgerbeteiligung. In dem Planungsabschnitt, den wir mitbetreuen, gibt es verschiedene Varianten und Trassierungsmöglichkeiten. Hier benötigen wir eine starke GIS- und BIM-Integration.
Ist GIS und BIM also ein Dream Team?
Scharun: Beide Werkzeuge standen bislang isoliert. Werden diese Daten wie beim Brenner Nordzulauf jedoch kombiniert, so entstehen ganz neue Synergien. Aus dem Geoinformationssystem ArcGIS von Esri stammen beispielsweise dort hinterlegte Karten, die mit weiteren Informationen wie Daten aus einer Bohrung angereichert werden können. Dazu kommen dann unsere Planungsdaten aus der CAD-Welt. Diese BIM-Modelle werden zudem genutzt, um Prozesse während des Baus zu simulieren und eventuelle Korrekturen bereits in der Planungsphase vorzunehmen. Zudem können die notwendigen Baustelleneinrichtungsflächen sowie Baulogistikvorgänge anhand der Modelle geplant werden. Außerdem ist für die Planung die Verknüpfung mit weiteren Faktoren wie Kosten und Zeiten wichtig, die sogenannte 4D- und 5D-Modellierung.
Wie sieht die Verknüpfung der Systeme in der Praxis aus?
Scharun: Ein Autodesk-Nutzer beispielsweise kann in seinem gewohnten CAD-Umfeld über den Living-Atlas auf GIS-Daten von Esri zugreifen – der GIS-Spezialist wiederum öffnet sich die CAD-Welt. So können CAD-Konstrukteure Bauwerke wie eine Brücke, die sie planen, in ihrem geographischen Kontext sehen – und frühzeitig Planungskonflikte erkennen.
Ein weiteres Leuchtturmprojekt in Sachen BIM/GIS ist ein Neubauabschnitt der Hamburger U-Bahn. Um was geht es bei diesem Vorhaben?
Scharun: Im Auftrag der Hamburger Hochbahn AG sind wir an Planung und Management der Erweiterung der U-Bahn-Linie 4 im Osten Hamburgs beteiligt. Die Strecke wird um 2,5 km und zwei neue Haltestellen erweitert.
Was sind hier die besonderen Herausforderungen?
Scharun: Der innerstädtische Bau als solcher ist kompliziert, da um bestehende Infrastruktur herum gebaut werden muss. Die vorhandenen Gebäude müssen während der Ausführungsphase überwacht und gesichert werden, was bei der teilweise 100 Jahre alten Bausubstanz immer wieder zu Überraschungen führt. Dies betrifft auch die im Untergrund verlaufenden Leitungen und Kabel der verschiedenen Spartenträger, deren Lage oftmals nur sehr ungenau bekannt ist. Während der Baumaßnahmen muss der Betrieb auf den Straßen und der U-Bahnlinie sowie der Sparten natürlich weiterlaufen.
Wie meistern Sie die Herausforderungen?
Scharun: Auch hier setzen wir wie beim Brenner Nordzulauf auf BIM und GIS. Mit GIS-basierten Systemen und BIM-Modellierungen haben wir den Vorteil, dass Projekte von Anfang an greifbar sind. Wir haben georeferenzierte Daten zur Verfügung und sehen zum Beispiel, welche Häuser unter Denkmalschutz stehen und wie viele Bäume auf geplanten Baustelleneinrichtungen stehen.
Wie stellen Sie Kommunikation und Kollaboration sicher?
Scharun: Das A und O bei diesen Projekten ist eine saubere Kommunikation und Koordination – und das digital. Über die WebGIS-Plattform und die CDE werden alle Daten laufend zusammengeführt. Alle Projektbeteiligten und Fachplaner haben damit immer die Möglichkeit, auf den aktuellen Projektstand mit allen relevanten Informationen zugreifen zu können. Auch der Öffentlichkeit können über Web-GIS-Plattformen die Lösungen frühzeitig und nachvollziehbar präsentiert werden.
Welche Rolle spielt der Digitale Zwilling?
Scharun: Er spielt eine Hauptrolle. Mit dem Digitalen Zwilling können wir Projekte managen, visualisieren, Simulationen durchführen und Informationen teilen, um die besten Entscheidungen zu treffen. Wenn es dann darum geht, das Projekt zu realisieren und zu betreiben, steht mit dem digitalen Infrastrukturzwilling ein großer Datenfundus zur Verfügung, der den ganzen Lebenszyklus des Bauwerkes perfekt unterstützt. Schließlich ist der Digitale Zwilling ein Gesamtwerk aller Projektbeteiligten: Vom Ingenieur, über die Beschäftigten in der Verwaltung bis hin zum Baggerfahrer.
Wie wichtig ist die Cloud für digitales Planen und Bauen?
Scharun: Cloud-Nutzung ist mittlerweile ein Muss. Das betrifft zwei Aspekte: Zentrale Bereitstellung der Daten für alle Projektbeteiligten und Cloud-Computing für die rechenintensiven Prozesse in den Projekten. Dazu nötig ist die Rechenpower großer Rechenzentren. Der Vorteil: Alle Beteiligten arbeiten an einem Modell, sicher gelagert in einer Cloud. Am immer aktualisierten Modell entstehen weniger Missverständnisse, es müssen keine neuen riesigen Dateien hin und her geschickt werden und veraltete Datenstände gehören der Vergangenheit an. Das beschleunigt die Planungszeit und fördert den fehlerfreien Datenaustausch.
Wie zahlt Digitalisierung auf das Thema Nachhaltigkeit ein?
Scharun: Digitalisierung ist ein wichtiges Werkzeug für Nachhaltigkeit. Dabei gibt es viele Aspekte. Der Brenner-Nordzulauf beispielsweise soll die notwendigen Kapazitäten schaffen, um den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern und damit insbesondere die hochbelastete Inntalautobahn zu entlasten. Durch die digitale Unterstützung bei der Trassenfindung und dem Variantenvergleich können Eingriffe in die Umwelt minimiert werden. Baustellenabläufe lassen sich optimieren und ressourcenschonend durchführen. Noch ein Beispiel: Sonnenverlauf und Beschattung sowie Standortanalaysen wirken sich auf den operativen Betrieb eines Bauwerks aus. Diese Faktoren können früh berücksichtigt werden. BIM und GIS eröffnen dabei den holistischen Blick.